6.
Leben »» Freude am Leben »» Freude am
Chefetage
… geschützt und abgeschirmt … Büro‑, Handels- und Wohnkomplexe … der
Allgemeinheit verpflichtet … Idee: private Alten-Universität
Hirschberg fuhr zu seinem Termin mit Herrn Schneider nach Köln. Dessen Bürositz zu finden, verlangte viel Orientierungssinn. Zuerst musste man die Einfahrt zur Tiefgarage des Gebäudes finden. In ein Netz von Einbahnstraßen musste man sich dazu richtig einfädeln. Über einen Sprechkontakt an der Säule vor der Schranke: seinen Namen nennen und sagen, zu wem man wollte. Da Hirschberg angemeldet war, hob sich gleich darauf die Schranke. Er fuhr hinunter. Die Beleuchtung sprang an. Er fand einen der reservierten Firmenparkplätze frei. Durch eine feuersichere Tür gelangte er in den Vorraum zum Aufzug. Kameraaugen überall. Mit dem Lift in das oberste Stockwerk. Wieder eine Gegensprechanlage.
Die Tür öffnete sich und er wurde von einer Mitarbeiterin des Unternehmens begrüßt. Sie führte ihn durch einen langen Gang, dann rechts ab, schließlich eine Treppe hoch in einen besonderen Bürotrakt, zu dem sie einen Schlüssel hatte. Die edel ausgestattete Chefetage. Über einen kleineren Gang kamen sie in das Wartezimmer von Schneider, dem Big Boss. Kaffee, Tee, Saft oder Wasser?. „Wasser bitte.“
Die Tür zu einem der beiden angrenzenden Räume stand offen. Drei Computerarbeitsplätze. Die Tür gegenüber war geschlossen, sie hatte keine Klinke, sondern einen Knopf. Dahinter residierte also Schneider, geschützt und abgeschirmt. Als Hirschberg vor Jahren schon mal mit ihm zu tun hatte, war seine Adresse eine andere, stand sein Büro wie alle offen und die Einrichtung war bescheiden. Jetzt hingen an den Wänden Ölgemälde auf Seidentapete, war der Warteraum mit englischen Stilmöbeln bestückt, lag ein Orientteppich aus.
Ein junger Mann kam zu Hirschberg und stellte sich als Assistent von Herrn Schneider vor. Er möge bitte noch einen Moment Geduld haben, Herr Schneider habe noch einen Besucher. Aber das Gespräch sei gleich zu Ende. Ob man ihm irgend etwas anbieten dürfe? Nein, danke, das habe man bereits getan.
Ein anderer junger Mann kam, grüßte freundlich und berührte einen Taster an der Tür mit dem Knopf. Die Tür sprang auf und schloss sich wieder hinter dem Mitarbeiter. Dort saßen, so konnte Hirschberg erkennen, die Sekretärinnen Schneiders. Er checkte den Warteraum. Wo war hier das Kameraauge?
Er hasste diese Wartesituationen. Hatte er etwa Zeit zu verschwenden? Diese entschuldigenden Nettigkeiten, mit denen kaschiert, aber nichts geändert wurde, waren ihm zuwider. Und er war sich nie sicher, ob nicht eine Machtdemonstration dahintersteckte: Ich kann es mir leisten, andere warten zu lassen; meine Zeit ist kostbar, die Zeit anderer nicht. Außerdem sollte der Besucher mit Respekt feststellen, in welch ehrwürdigen Räumen er sich aufhalte. Immerhin: Schneider musste dieses Ambiente zuerst durch unternehmerische Leistung verdienen. In Ministerien wurde der Karriere-Status mindestens genauso ausgeprägt herausgestellt – aber auf Kosten der Steuerzahler.
Mit solchen Spielchen konnte man eine Verhandlung bereits im Vorfeld psychologisch so aufbereiten, dass man dem Besucher gegenüber Macht und Größe suggerierte. Im Chefzimmer ließ sich die Inszenierung von Überlegenheit fortsetzen: Großer kostbarer Schreibtisch am Ende des Raumes vis-à-vis der Tür, durch die der Besucher eintritt, langer Läufer auf den Schreibtisch zu.

Dann das Begrüßungsritual: Entweder Missachtung des Eintretenden durch Sitzenbleiben hinter dem Schreibtisch – beispielsweise Mitarbeitern gegenüber, die um einen vertraulichen Termin gebeten hatten und sich vermutlich über etwas beschweren wollten. Oder nicht ganz so deutliche Geringschätzung durch Aufstehen oder eine gewisse Aufmerksamkeit durch Entgegenkommen auf halbem Weg.
Im Gegensatz dazu: Wertschätzung signalisieren – gespielt oder ehrlich – durch Begrüßung an der bereits geöffneten Tür. Hirschberg war sich sicher, dass Schneider dieses ganze Repertoire beherrschte. Er war ein Machtmensch.
Die Tür mit dem Knopf sprang auf, Schneider ging auf Hirschberg zu, schüttelte ihm kräftig die Hand und donnerte ein „Herzlich willkommen!“
Er musterte Hirschberg: „Haben Sie abgenommen? Schlank waren Sie ja schon immer. Ich kann Ihnen ein paar Pfund abgeben.“
Durch den Raum seiner beiden Sekretärinnen führte er ihn in sein herrschaftliches Büro. Die Ausstattung war Designerarbeit. Alles aus Stahlrohr, Stahlblech und Glas. Die Sessel der Sitzgruppe aus schwarzem Leder. Der Schreibtisch: graues Stahlrohr, graue Stahlplatte als Vorderseite, dicke Glasscheibe als Arbeitsplatte. Schwarzer Ledersessel dahinter.
Schneider führte ihn zu einer der frei im Raum stehenden Vitrinen, in denen Modelle von Baukomplexen ausgestellt waren.
„Das haben wir gerade vor ein paar Wochen in Berlin eingeweiht. Ein großartiger Erfolg. Schon vor der Eröffnung war alles verkauft oder vermietet. Einer der modernsten Büro‑, Handels- und Wohnkomplexe in Europa, direkt in Berlin Mitte, an alle Verkehrswege angeschlossen. Ein Vorzeigeobjekt der neuen Hauptstadt. Deshalb hat es sich der Bundeskanzler auch nicht nehmen lassen, bei der Einweihung persönlich anwesend zu sein.“
Mit stolz geschwellter Brust stand Schneider davor, ließ seinen Blick, wie wohl häufig schon, auf dem Objekt ruhen, und sah dann Hirschberg an, ob dessen Miene denn auch die angebrachte Würdigung zeige. Der spürte den Blick, nickte anerkennend und erklärte: „Alle Achtung! Das ist unter den heutigen Bedingungen auf dem Baumarkt eine grandiose Leistung. Ich gratuliere Ihnen.“
„Danke! Leider ist unsere Branche durch meinen Namensvetter, mit dem ich weder verwandt noch verschwägert bin, ein wenig in Verruf gekommen. Daher war es für uns eine besondere Ehre, dass der Kanzler dabei war.“
Mit einer Handbewegung lud er ihn ein, in der Sitzgruppe Platz zu nehmen. Auf einem Beistelltisch Thermoskannen mit Tee und Kaffee, Geschirr. Auf dem Couchtisch zwei Zigarrendosen, Knipser, Feuerzeug und Aschenbecher. Jeder Gegenstand für sich nicht nur auf seine Funktion hin, sondern auch mit Bedacht auf guten Geschmack ausgesucht. Keine Frage: Hier arbeitete einer, der sich zur Elite der schaffenden Menschheit zählte. Schon immer hatte das Baugewerbe Menschen angezogen, die sich verewigen wollten, sei es als Bauherren, als Architekten oder eben als Projektentwickler.
Schneider lehnte sich zurück: „Das Geschäft ist knochenhart geworden. Sie glauben gar nicht, was auf dem Markt los ist. Der Wettbewerb ist dabei nicht mal das Schlimmste. Da verstehen wir uns schon zu behaupten. Die Gewerkschaften und der Staat machen uns das Leben schwer. Der Staat mit seinen immer neuen Gesetzen, Auflagen, Genehmigungsverfahren, Kontrollen, die Gewerkschaften mit ihrem ständigen Druckmachen, mit dem sie noch die kleinste Kleinigkeit an Arbeitsleistung absichern und höher bezahlt haben wollen.
Er klagte weiter: „Für jeden Handgriff, für jeden Arbeitsschritt, für jede Minute Arbeitszeit müssen wir verhandeln oder uns vor Gericht verantworten. Wir sind in unseren Handlungsspielräumen schon so eingeengt, dass wir unsere unternehmerische Flexibilität weitgehend verloren haben. Manchmal frage ich mich, warum ich mir das alles noch antue. Wenn ich keine Kinder hätte, säße ich jetzt vermutlich auch auf Mallorca und würde die Sonne genießen.“
„Ich wette, nach einiger Zeit würde Ihnen die Arbeit fehlen!“
„Sagen Sie’s nicht, ich würde gerne mal faulenzen. – Aber wahrscheinlich haben Sie recht.“
Schneider fragte, ob er Kaffee oder Tee nehme, beides sei gerade frisch aufgeschüttet worden – und schenkte dann wunschgemäß mit gastfreundlich dienender Geste Tee ein. Das machte ihn Hirschberg fast sympathisch.
Zigarre? Nein. Sich selber nahm er eine Zigarre aus einer der Dosen, bereitete sie vor und zündete sie an. Mit dem Ausstoßen der ersten Qualmwolke lehnte er sich wieder zurück. Mit der Hand verwedelte er den Rauch. Der etwas untersetzte, vom leckeren Essen und mangels Bewegung opulente Herr in vorgerücktem Alter noch mit prächtigem blonden Haar, gekleidet in feinen Zwirn, kam zur Sache.
Mit seinen graugrünen Augen nahm er Hirschberg ins Visier: „Meine Frau hat Sie also angeheuert. Sie will in Mallorca etwas aufziehen. Im Prinzip kann ich das nur befürworten. Dann hat sie etwas zu tun. Aber ich wüsste gerne, was dahinter steckt. Von Ihnen will sie ein Konzept. Aber für die Veranstaltung von ein paar Vorträgen brauche ich keinen Berater. Was hat sie Ihnen gesagt, was Sie machen sollen?“
Hirschberg antwortete, dass er genau das ihr auch gesagt habe. Er vermute, sie wolle sicher gehen, keinen Flop zu landen. Doch das Risiko könne ihr keiner abnehmen. Auch habe er ihr gesagt, dass er die Organisation der Veranstaltung nicht übernehmen wolle. Denn das sei nicht sein Job. Aber man könne ja auch an etwas mehr als ein paar Vorträge denken. Dafür habe sich seine Frau offen gezeigt. Dazu solle er ein Konzept machen. Das solle er in vier Wochen in Andratx präsentieren.
Schneider: „Da weiß ich ja gar nichts von.“
Er nahm sein Telefon, das er vom Schreibtisch mitgebracht und vor sich hin gelegt hatte und gab Anweisung, eine Verbindung zu seiner Frau herzustellen.
Zu Hirschberg: „So läuft das natürlich nicht. Wenn ich bezahlen soll, dann will ich informiert sein, und dann treffe ich auch die Entscheidungen. Dann präsentieren Sie mir und nicht meiner Frau. Und das hier in Köln! Und nicht in Mallorca. Sie verstehen das, hoffe ich.“
„Die Vereinbarung mit Ihrer Frau ist damit aufgehoben?“
„Genau das.“
„Und was soll ich für Sie machen?“
„Darüber können wir gerne reden. Aber vorher will ich mit meiner Frau sprechen.“
Das Telefon klingelte. Er nahm es auf: „Hm! Versuchen Sie‘s weiter!“
Zu Hirschberg: „Haben Sie sich denn schon Gedanken gemacht?“
„Ich habe ein paar Recherchen-Aufträge vergeben und eine erste Ideensammlung gemacht.“
„Das war aber ein wenig voreilig. Konnten Sie unseren Termin heute nicht erst abwarten?“
„Ich dachte, Ihre Frau könne so etwas entscheiden.“
„Wir haben auch recherchiert.“
Er nahm wieder das Telefon: „Herr Wolter soll mal eben zu mir kommen.“
Wieder zu Hirschberg: „Was wir natürlich brauchen könnten, wäre eine Imageverbesserung. Wenn Sie da die Idee zu einer Aktion hätten, die öffentlichkeitswirksam deutlich macht, dass wir uns durchaus der Allgemeinheit verpflichtet fühlen, dann könnte das hilfreich sein, und wir könnten überlegen, ob wir das machen wollen. Aber so einfach drauf los, so etwas bezahle ich nicht.“
„An wen soll ich mich denn nun halten? An Sie oder an Ihre Frau?“
„Ich bin Ihr Auftraggeber – wenn wir…“, er sah auf die Uhr, „wenn wir in der nächsten halben Stunde zu der Ansicht kommen, Sie könnten sich für uns nützlich machen.“
Hirschberg machte eine Anspielung auf den Professor: „Manchmal ist es erfolgreich, sich an die Frau eines Mäzens zu halten …“
„Da würde der Professor mich aber ganz falsch einschätzen. Wenn er glauben sollte, auf dem Weg über meine Frau an sein Ziel zu kommen, hat er sich geirrt.“
Herr Wolter wurde ihm gemeldet.
„Soll reinkommen!“
Begrüßung, Vorstellung, Aufforderung, sich dazu zu setzen.
„Haben Sie schon etwas herausgefunden?“
Wolter: „Bis vor zwei Jahren Professor in Bochum für Kunstgeschichte, vorzeitig aus Gesundheitsgründen in den Ruhestand getreten. Vor zehn Jahren hat er sich scheiden lassen – oder seine Frau, weil er ein Verhältnis mit einer seiner Studentinnen hatte. Drei erwachsene Kinder. Seit einem Jahr wohnhaft auf Mallorca. In Deutschland noch eine Eigentumswohnung in Essen.“
„Na, das ist doch schon was. Bleiben Sie dran. Mich würde interessieren, wie seine Vermögensverhältnisse sind, ob er hier in Deutschland sich noch irgendwie betätigt, als Kunstberater oder so, und was ihn nach Mallorca gebracht hat – für einen Kunstgeschichtler gibt es attraktivere Gegenden. Danke schön. Das war’s für den Augenblick.“
Wolter verließ den Raum. Schneider zu Hirschberg: „Ich habe gelernt, Vertrauen nur aufgrund von Fakten zu schenken. So viel Menschenkenntnis kann keiner haben, dass man ihn nicht doch täuschen könnte. Und alle, die behaupten, sie hätten ein Gespür für die Wahrhaftigkeit von Menschen – Frauen behaupten das gerne von sich –, die belügen sich.“
Schneider zog an seiner Zigarre und fuhr fort: „Also, Sie sprachen davon, dass Sie schon Ideen gesammelt hätten. Wäre eine dabei, von der Sie auf Anhieb sagen würden, damit kann der Schneider aller Welt zeigen, dass er nicht nur viel Geld verdienen kann, sondern zum Wohle der Menschheit auch damit umzugehen versteht. Sagen Sie jetzt nur nicht, dass ich Kunstmäzen werden sollte, womöglich noch unter der fachkundigen Beratung von Prof. Dr. Godehard Martin, so heißt nämlich der Mann aus dieser schrecklichen Ruhrgebiets-Universität. Kein Wunder, dass er krank geworden ist. Wir haben hier in Köln schon ein Museum Ludwig. Der Peter Ludwig verstand viel von Kunst, dieser Schokoladen-Fabrikant. In dessen Fußstapfen will ich nicht treten. Schlagen Sie mir etwas anderes vor!“

Hirschberg begann zögerlich. Dieser Mann war so dominant, dass es ihm schwer fiel, sich zu konzentrieren, sich zu behaupten. Daher spielte er schon die ganze Zeit mit dem Gedanken, diesen Auftrag sausen zu lassen. Außerdem geriet er womöglich in die Beziehungsprobleme des Ehepaars Schneider. Zweifelhaft war auch, ob eine erfüllbare Aufgabenstellung durch Schneider überhaupt möglich wäre, ob er, Hirschberg, nicht zum Spielball von Eitelkeiten und Herrschsucht würde. Er verspürte wenig Lust, mit diesem Erfolgsmenschen, der die Menschen seines Umfelds unwiderstehlich auf sich zu orientieren pflegte, zusammenzuarbeiten.
Hirschberg sagte: „Das ist alles noch nicht ausgereift. Nur erste Überlegungen, nach dem, was mit Ihrer Frau besprochen wurde.“
„Das hat Sie aber doch nicht ganz befriedigt, wie Sie eben durchblicken ließen. Womit könnte ich mich befassen, was sollten die Leute mit meinem Namen, Johann Heinrich Schneider, verbinden. Ich weiß, das klingt eitel, aber ich habe nun mal eine Position erreicht, in der ich mich in gewisser Weise verpflichtet sehe. Um Ihnen meine Situation zu verdeutlichen: Ich führe zwar noch das Unternehmen alleinverantwortlich, aber der Generationswechsel ist eingeleitet. Sie haben schon richtig vermutet, dass ich mich dann nicht zur Ruhe setzen will. Was könnte der Schneider nach seinem Abgang aus der Firma Sinnvolles machen?“
Mit dieser Frage hatte er Hirschberg, den eben noch zögerlichen, gezündet. Wie der Schneider sich ein Denkmal setzen und der Allgemeinheit einen Dienst erweisen könnte, dazu hatte er eine Idee, und die ließ er nun raus: „Sie wissen, dass der Bevölkerungsteil der alten Menschen in Deutschland steigt. Viele dieser älteren Menschen sind noch recht fit. Nachdem sie in ihren Berufsjahren eine solide Alterssicherung aufgebaut haben, können sie jetzt ihren Interessen, ihren Hobbies und Neigungen nachgehen. Die Veranstalter von Bildungsreisen für Senioren melden steigende Nachfrage. An den Universitäten steigt die Zahl der älteren Semester, nämlich der Senioren, die teilweise noch einen Abschluss machen und einen akademischen Grad erwerben. In Baden-Württemberg ist eine private Alten-Universität eröffnet worden. Es gibt Alten-Clubs, einen Zentralverband der älteren Mitmenschen, spezielle Zeitschriften für alte Mitmenschen. Die Parteien haben Senioren-Vereinigungen. Was halten Sie von einer Europäischen Senioren-Universität?“
Schneider sah ihn mit großen Augen an. So auf Anhieb gefiel ihm die Idee. Hirschberg schob nach: „Die Johann-Heinrich-Schneider-Universität!“
„Klingt gut! Aber das kostet ja nicht nur ein paar Mark, sondern muss mit viel Sachverstand und Organisationsgeschick angepackt werden. Und dann all die bürokratischen Widerstände. Aber ich will die Idee nicht kaputtreden. Darauf verstehen sich andere besser. Wenn Sie einverstanden sind, können wir folgendermaßen verbleiben: Sie erstellen ein Konzept, wie ein Projekt Senioren-Universität aussehen und angegangen werden müsste, so konkret wie möglich, nicht lauter Überlegungen, die anfangen mit ‘man könnte’ und ‘es ließe sich denken’. Auch finanzielle Größenordnungen sollten drinstehen. Als Honorar biete ich Ihnen 20.000 DM.“
Hirschberg überlegte einen Moment und sagte dann: „Einverstanden. Frage noch: Der Termin in Andratx ist damit hinfällig!“
„Selbstverständlich. Aber da brauchen Sie sich nicht drum zu kümmern. Das regele ich. Schicken Sie mir in etwa zwei Monaten Ihr Papier. Danach vereinbaren Sie mit meinem Büro bitte einen Termin.“
Er stand auf, begleitete Hirschberg noch in den vorgelagerten Sekretariatsraum, bat eine der beiden Mitarbeiterinnen, Hirschberg zu begleiten, damit er rausfinde, und sagte: „Hat mich gefreut! Ich bin sehr gespannt.“
Aus Köln zurück überdachte Hirschberg nochmal das Gespräch mit Schneider. Ihn ärgerte, dass er sich hatte so bestimmen lassen. Andererseits sagte er sich, dass man solchen Menschen nur Paroli bieten konnte, wenn man eine entsprechende Position bekleidete. Er war nur ein kleiner käuflicher Ideenlieferant, einer von denen, die man für seine Zwecke engagierte – mehr nicht. Ein persönliches Interesse an der Person Hirschberg hatte Schneider wohl kaum. Wahrscheinlich war solchen Leuten effektives und zielgerichtetes Arbeiten nur aufgrund einer ausgeprägten Egozentrik möglich. So gewannen sie die Durchschlagskraft, die sie zur Überwindung der zahlreichen Hindernisse bei der Umsetzung ihrer Vorhaben brauchten.
Wer mit solchen Typen nicht klar kam, musste sie meiden. Hirschberg war unsicher, ob es richtig war, sich herauslocken zu lassen, statt auszusteigen. Jetzt hatte er sich indes drauf eingelassen, jetzt würde er ein Konzept liefern. Und dann würde er sich zurückziehen. Der Schneider konnte dann damit machen, was er wollte.
Das mit Frau Schneider war natürlich dumm. Doch sie jetzt anrufen und ihr von dem Gespräch mit ihrem Mann berichten, würde ihn erst recht in die Ehegeschichte hineinziehen. Er beschloss, sich nicht zu melden. Wenn sie von sich aus anrief, würde er ihr mitteilen, dass ihr Mann die Angelegenheit direkt mit ihm regeln wolle. Er gehe davon aus, alles werde in ihrem Sinn verlaufen. Die Präsentation in Andratx sei hinfällig. Ihm fiel ein, er müsse Katha noch Bescheid geben, dass aus dem Flug nach Mallorca nichts würde. Doch sie war nicht erreichbar.
Hirschberg ging in sein Büro und machte sich wieder an sein Buch. Endlich ging das Schaffen zügig voran. In den nächsten Tagen hielt Frau Michalski alle Ablenkungen von ihm fern. Mittags wurde gemeinsam gekocht. Auch da machte Hirschberg Fortschritte, allerdings nur langsam. Er merkte, was man in der Küche alles falsch machen kann, wie es auf die richtige Dosierung, die Reihenfolge, die Kombination, Temperatur und viele Feinheiten ankam. Alleine hätte er die doppelte und dreifache Zeit gebraucht, wäre ihm vieles auch daneben gegangen. Aber unter Frau Michalskis Regie bekam er Gespür dafür, wie die Abläufe waren und in welchen Momenten man besonders aufpassen musste.
Schon beim Einkaufen war darauf zu achten, dass man die richtigen Lebensmittel auswählte. Hin und wieder begleitete er Frau Michalski, um die Qualitäten unterscheiden zu lernen und die Mengen einschätzen zu können. Ihm wurde klar, man musste das tagtäglich machen, um ein sicheres Gefühl zu bekommen, Variationen zu wagen und Geschmacksveränderungen auszuprobieren.
Auch bekam er ein anderes Verhältnis zum Essen. Jahrzehnte lang hatte er sich einfach an den Tisch gesetzt, gegessen, und nach zwanzig Minuten war er wieder weg. Dieses Kantinenverhalten legte er nunmehr ganz von allein ab. Was er aß, kannte er jetzt auch im Roh- beziehungsweise Ausgangszustand. Er wusste, wie es genießbar, wie eine Speise daraus geworden war.
Er dachte daran, dass die Menschen früherer Zeiten unmittelbar und viel intensiver Tag für Tag mit ihrer Ernährung beschäftigt waren. Die Mehrzahl der Menschen musste anpflanzen, zur Ernte bringen und speichern, was sie für ihr Überleben brauchte. Der Handel bot keine konsumfertig vorbereiteten Lebensmittel. Die Vorfahren verbrachten viel Zeit mit der Zubereitung von Speisen. Die Erträge der Bauern hingen von Wetterwechseln und Klimaschwankungen ab. Es gab Hungerkatastrophen. Die Vaterunser-Bitte „Unser tägliches Brot gib uns heute!“ hatte erfahrbare Bedeutung. Kriege wurden um fruchtbare Gegenden geführt.
Alle diese Erfahrungen, dieses Wissen um die Abhängigkeit von den Gaben der Natur war in unserer Zeit abhanden gekommen. Andererseits war die Lebensweise mit Supermarkt und McDonald’s eine ungeheure Befreiung der Menschen. Sie konnten sich anderen Aufgaben und Tätigkeiten zuwenden. Manche jungen Leute wollten allerdings die Erfahrung machen, wie man in der freien Natur überleben kann. Überlebenstraining – wenigstens mal eine Woche lang. Aussteiger machten eine Lebensphilosophie daraus.
Schließlich: Hirschberg kannte Teile der Dritten Welt und wusste daher, dass die Menschen in Europa auf einer Wohlstandsinsel leben, in weiten Teilen der Welt aber Hunger herrscht. Er gewöhnte sich an, nach dem Hinsetzen an den Mittagstisch, sich in einer Haltung der Dankbarkeit die Situation in der Welt zu vergegenwärtigen. Zuhause bei seinen Eltern wurde vor dem Essen gebetet.
In Erinnerung geblieben war ihm der Ausspruch seiner Mutter: Da mühe sie sich den ganzen Vormittag ab und in einer Viertelstunde sei alles verschlungen. Ihr bliebe nur noch der Spül. Auch meinte sie schon mal, Lob gäbe es selten, aber wenn etwas nicht so gut schmecke, würde gemeckert. Dass junge Frauen heute nicht mehr kochen wollten, lag sicherlich auch an der Geringschätzung, ja Undankbarkeit, die sie als kleine Mädchen gegenüber der Arbeit ihrer Mutter mitbekommen hatten. Hirschberg war der Meinung, es werde sich an einer Gesellschaft rächen, wenn sie den Bezug zu den unmittelbaren Überlebenszusammenhängen verliere.
Vater bekocht Tochter
… Priorität vor allem anderen … mache dir mein Lachsfilet … sie war in
Hochstimmung … sie habe einen Freund … ein lieber Mensch … Thomas hat mir
geschrieben … voller Freude über seine Kinder …
Das Wochenende mit Katha und ihrem Freund stand bevor. Sie meldete sich am Freitagmorgen, um nach der Wegbeschreibung zu fragen. Hirschberg sagte ihr bei der Gelegenheit, dass aus dem Flug nach Mallorca nichts werden würde, weil der Auftrag sich anders entwickelt hätte. Sein Gesprächspartner sei nicht mehr Frau, sondern Herr Schneider. Nach einem ersten Moment der Enttäuschung, fragte sie, ob es denn möglich sei, den für morgen und übermorgen verabredeten Besuch bei ihm in der Eifel auf das jetzt freie Mallorca-Wochenende zu verschieben; ihr Freund müsse nämlich eigentlich für eine Prüfung lernen. Hirschberg meinte, er wolle nicht schuld sein, wenn ihr Freund durch die Prüfung falle: „Also verschieben wir“.
Ihm kam das nicht ungelegen. So konnte er seine Manuskript-Arbeit ohne Unterbrechung durchziehen. Und die ging ihm immer besser von der Hand. Bisweilen konnte er gar nicht so schnell schreiben, wie ihm die Gedanken zuflossen. Die Momente, in denen es hakte, er nicht weiterkam, wurden seltener. Von Zeit zu Zeit erlebte er geradezu einen Schreibrausch. Er hatte den Eindruck, nicht er schreibe, sondern es schreibe aus ihm heraus. Die nächsten Schritte waren dann: Frau Michalski tippt den Text in den Computer, ausdrucken, redigieren, das Manuskript Verlagen anbieten.
Der neue Termin mit Katha und ihrem Freund kam genau richtig. Nach der konzentrierten Schreibarbeit brauchte er Entspannung, Erholung, Geselligkeit. Schon am Donnerstag vorher wollte er nachmittags in die Eifel fahren. Frau Michalski redete ihm eindringlich zu, das Kochen mittags auch dort beizubehalten. Entsprechend kaufte er ein. Für Freitag hatte er Lachsfilet mit Butterkartoffeln und Blattsalat vorgesehen. Samstag wollte er Waffeln mit Sahnequark und Obstsalat machen. Sonntag kein Mittagessen, sondern Picknick auf der Venn-Wanderung mit seinen beiden Gästen.
Er saß schon im Auto abfahrbereit, als ihm einfiel, er könnte die Terrassentür nicht gesichert haben. Hin und wieder befielen ihn solche Zweifel. Habe ich die Haustür auch wirklich abgeschlossen? Sind alle Fenster zu? Und so weiter. Das passierte ihm immer dann, wenn er in Gedanken mit etwas anderem beschäftigt war, als er gerade tat.
Schon vor geraumer Zeit hatte er sich vorgenommen, eine Checkliste für die Haussicherung zu machen, aber dann doch wieder für überflüssig gehalten. Jetzt ging er also nochmal ins Haus, um nachzusehen. Er kam gerade ins Wohnzimmer, als das Telefon klingelte: seine Tochter. Sie sei in Köln, habe unerwartet freie Zeit und käme gerne zu ihm, gleich führe ein Zug nach Bonn. Hirschberg sagte, er sei zwar gerade auf dem Sprung in die Eifel und nur noch mal kurz ins Haus zurückgekommen – aber sie solle kommen. Wann der Zug denn in Bonn sei? „Okay, ich hole Dich ab.“
Er trug seinen Einkauf wieder ins Haus zurück und legte die verderblichen Sachen erneut in den Kühlschrank. Dann fuhr er zum Bahnhof. Dass seine Planung über den Haufen geworfen wurde, störte ihn zwar, aber er hatte den Grundsatz: Wenn seine Kinder zu ihm kommen wollten, hatte das Priorität vor allem anderen.
Hannelore war in bester Stimmung. Sie erzählte bereits im Auto, ohne dass ihr Vater mit vorsichtigen Fragen sie dazu animieren musste, vom Fortgang ihres Jurastudiums. In einem Jahr würde sie voraussichtlich ihr Referendar-Examen machen. Sie habe das Angebot, anschließend zu promovieren.
Hirschberg: „Die Frage ist, was du später machen willst. Wenn du eine juristische Karriere anstrebst, brauchst du das zweite Staatsexamen. Willst du in Bereichen tätig werden, die eine juristische Fundierung brauchen, aber nicht die praxisbezogene Weiterführung, könnte die Promotion von Vorteil sein. Für Spitzenkarrieren ist beides nützlich. Da du zügig studiert hast, kämest du vom Alter her nicht in Verzug.“
Sie sprachen noch über die eine oder andere berufliche Perspektive. Hirschberg nannte ihm bekannte Leute in Politik, Wirtschaft, Verbänden und internationalen Organisationen, die als Juristen in interessante und verantwortliche Positionen gekommen waren. In Mehlem angekommen, berichtete er ihr, dass er unter Frau Michalskis Anleitung das Kochen lerne.
„Das hätte ich wissen müssen, dann wäre ich schon heute Mittag gekommen!“
„Ich kann dir als Kostprobe einen Salat machen.“
Sie kam mit in die Küche, und gemeinsam bereiteten sie ein Abendessen vor. Aufgrund von Hirschbergs Einkauf schöpften sie aus dem Vollen. Ganz beiläufig, aber absichtsvoll, ließ sie die Bemerkung fallen, dass sie nichts zu Mittag gegessen habe – und Lachsfilet besonders gerne esse. Der Vater sah sie an, verharrte einen Augenblick und erklärte: „Na gut, ich mache dir mein Lachsfilet.“
„Wir teilen.“
Es wurde ein richtiges Festessen. Sie holte sogar das Feiertagsporzellan aus der Vitrine, nahm den Kerzenständer vom Kaminsims, wechselte die fast abgebrannte Kerze gegen eine neue aus und stellte ihn auf den Tisch. Sie legte die Tischdecke auf, die sie noch von ihren Geburtstagen her kannte, suchte farbenfrohe Servietten heraus, pflückte im Garten Blumen und kreierte einen prächtigen Strauß für die Festtafel – sie war in Hochstimmung.
Der Vater zog die Schürze aus und servierte. Zuerst gab es eine Gemüsesuppe, anschließend Lachs in Dillsoße mit Kartoffeln. Dazu Blattsalat, angemacht mit saurer Sahne und Kräutern. Als Getränk hatte er einen fünf Jahre alten Chablis aus dem Keller geholt. Nachtisch: Vanilleeis aus der Kühltruhe mit heißer Schokolade. Die Tochter machte ihm Komplimente, und er war stolz darauf, sich als Küchenchef bewährt zu haben.
Während des Essens gab es eine Überraschung für Hirschberg: Hannelore erzählte ihm, sie habe einen Freund. Sie hätten sich im Seminar kennengelernt, als sie sich bei einer Studienarbeit gegenseitig halfen. Er sei Amerikaner, studiere an der Columbia-University in New York und bleibe ein Jahr in Deutschland. Ein ganz toller Typ, unkompliziert, offen, warmherzig, intelligent und sehr aufmerksam. Dem Vorurteil, die Amerikaner seien oberflächliche Menschen, entspreche er gar nicht. Sie habe mit ihm schon recht tiefgründige Gespräche geführt.
Hirschberg hörte mit freudigem Herzen zu. Mit Fragen hielt er sich zurück. So unbeschwert wie jetzt hatte er seine Tochter lange nicht mehr erlebt. Dieses nüchterne, eher spröde Mädchen war auf den Mann getroffen, der es offenbar verstanden hatte, sie aufzuwecken. Das machte den Vater glücklich. Und dann fragte er etwas vorsichtig steif: „Empfindet ihr mehr als kollegiale Freundschaft zueinander?“
Sie lachte: „Du willst wissen, ob da mehr draus wird als eine Semesterbekanntschaft. Das weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, ist mir das auch egal. Was mich glücklich macht: Ich erlebe zum ersten Mal einen Mann, der geradewegs auf mich zukommt und sagt ‘Können wir das zusammen machen?’. Kein verstohlener Vorabcheck, kein Ignorieren, kein Provozieren – einfach: Hier bin ich! Können wir? Ohne Hintergedanken. Er ist ein lieber Mensch.“
Hirschberg dachte, das könne man so schnell wohl kaum feststellen. Er sagte: „Ich freue mich, dich so glücklich zu sehen. Auf dein Wohl!“
Sie erzählte von Erlebnissen mit ihm, von seiner Art Probleme anzupacken, mit Menschen umzugehen. Hirschberg wollte wissen, welche beruflichen Ziele er habe.
„Er will zunächst ins Big Business. Später möchte er in eine der großen internationalen Institutionen. Er spricht mehrere Sprachen: Deutsch, Spanisch, Arabisch. Er hat ein Jahr in Amman gelebt.“
„Wie alt ist er?“
„Er ist 26 und heißt Bob, Bob Kliger.“
Nach einer Weile: „Es gibt noch einen Grund zu feiern. Thomas hat mir geschrieben, einen langen Brief. Er will auch dir schreiben. Es geht ihm gut. Wahrscheinlich so gut, wie lange nicht mehr. Er hat eine Philippinin kennengelernt und lebt mit ihr zusammen. Sie erwarten ein Baby. Nächsten Monat wollen sie heiraten. Sein Projekt läuft gut. In einem halben Jahr wird die finanzielle Hilfe aus Deutschland beendet. Die Provinzregierung, die dann alles in eigene Regie übernimmt, hat ihm angeboten, in ihren Diensten weiterzumachen. Er hat angenommen. Er hat mich eingeladen, ihn zu besuchen.“
Hirschberg war den Tränen nahe. Gerade um seinen Sohn hatte er sich Sorgen gemacht. Über ein Jahr war er verschollen. Jetzt hatte er sich also zurückgemeldet. Es sah so aus, als habe er wieder Tritt gefasst, habe sein Leben wieder Perspektive bekommen. Wenn auch weit weg – wichtig war, dass er sein Scheitern in Deutschland überwunden hatte. Sein Sohn auf den Philippinen, die Tochter in Amerika, er in Mehlem. Familie heute.
Vater Hirschberg war glücklich. Seine Tochter übernachtete in ihrem Jugendzimmer. Nach dem gemeinsamen Frühstück kaufte er erneut ein und packte alles ins Auto für sein Eifelwochenende. Hannelore fuhr er zum Bonner Bahnhof. Unterwegs verriet sie ihm, dass sie für ein Auto spare. Er versprach ihr, etwas dazu zu tun. Gegen Mittag war er in seinem Eifeler Wochendhaus nahe Mützenich südlich von Aachen. Es gab nur ein bescheidenes Mittagessen: Rühreier mit Salat und Brot. Hirschberg war voller Freude über seine Kinder.
Sommerwochenende
… Besuch von Katha und ihrem Freund … Candlelight-Dinner …
Glühwürmchen … Picknick in märchenhafter Landschaft
Es war ein herrlicher Junitag. Wolkenloser Himmel. Die Luft flirrte über der Wiese vor der Veranda. Die Sommerblumen blühten. Das Holz des Hauses, von der Sonne durchwärmt, roch nach Süden. Die Grashüpfer zirpten. Hin und wieder ein angenehmer Lufthauch. Hirschberg lag auf der Veranda im Liegestuhl.
Ihm kamen die Bilder von glücklichen Tagen mit seiner Frau und den Kindern in den Sinn. Sie machten Zelturlaub in Schweden. Es war auch Juni und ein Wetter wie heute. Mit ihrem Paddelboot befuhren sie den See, an dessen Rand ihr Campingplatz lag. Das Boot aus Aluminium hatten sie gemietet. Vorne saß seine Frau, hinten er, in der Mitte die Kinder. Jeder von ihnen hatte eine Schwimmweste an. Das war Vorschrift.
Für die Bootsfahrer gab es Wanderrouten. Wo es keine Wasserverbindung zwischen den einzelnen Seen gab, musste das Boot auf einem Weg über Land geschoben werden. Mit einem kleinen Bootswagen, der mitgemietet wurde. Um das Boot aus dem Wasser zu ziehen und wieder hineinzuschieben, gab es Rutschbahnen aus Baumstämmen.
An manchen dieser Stellen gab es Übernachtungsplätze. Die bestanden aus einem Holzverschlag als Wetterschutz mit offener Vorderseite, einem Holztisch mit zwei Bänken, einem Grillplatz und einem Stapel Holz mit Holzklotz und Beil. Gegen Abend wollten die Hirschbergs an einem solchen Platz sein, den sie bei einer früheren Tour entdeckt hatten. Dort wollten sie übernachten. Jetzt glitten sie leise über das Wasser, setzten nur selten die Paddel ein. Sie genossen die Landschaft, beobachteten die Vögel. In die eine oder andere der vielen Buchten fuhren sie hinein, lauschten den Tierlauten in der Uferböschung.
Gegen Mittag suchten sie eine Anlegestelle, zogen das Boot hoch und richteten sich im Wald einen Essplatz her. Nach dem Essen legten sich die Eltern unter eine Kiefer, streckten behaglich die Glieder von sich und ruhten. Die Kinder gingen zum Baden. Mit diesen Erinnerungen schlief er ein.
Wagentüren klatschten. Katha und ihr Freund waren da. Hirschberg erwachte und empfing die beiden an den Stufen zur Veranda. Sie umarmte und küsste ihn herzlich. Dann stellte sie vor: Günter Franken, Herr Hirschberg. Er rückte die Korbsessel zueinander und bat, Platz zu nehmen. Sie sah sich um und meinte, schön habe er es hier. Ob die Fahrt gut war und ob sie es gleich gefunden hätten, wollte er wissen. Kein Problem, ohne Stau durchgekommen, einmal im Ort gefragt. Etwas zu trinken? Wasser.
Während Hirschberg ins Haus ging, standen die beiden wieder auf, um mehr vom Gelände sehen zu können. Mit Gläsern und zwei Wasserflaschen kam Hirschberg zurück, stellte ein Tischchen in die Reichweite der Sessel und schenkte ein. Dann trat er an die Seite seiner beiden Besucher und bot ihnen einen kleinen Rundgang an.
„Gerne!“
Er erläuterte ihnen den Zweck der hohen Buchenhecke, die in einiger Entfernung an der Westseite des Nachbarhauses stand. Das sei in früheren Zeiten der Wetterschutz in dieser Gegend gewesen. Regen und Schnee peitschten im Herbst und Winter von Westen und Nordwesten über das Hohe Venn und die Nordeifel. Dies seien die ersten nennenswerten Erhebungen, die sich den Stürmen entgegenstellten, die vom Atlantik kämen und manchmal Orkanstärke erreichten.
Sie durchstreiften die Wiesen. Durch einen kleinen Birkenhain kamen sie zum Haus zurück. Sie nahmen wieder Platz. Er zöge sich immer wieder gern an diesen Ort zurück, um zur Ruhe zu kommen, seinen Gedanken nachzuhängen, sagte Hirschberg. Der Sommer – wenn er so ausfalle wie das Wetter heute – sei hier oben eine wunderbare Zeit. Es sei nie drückend heiß, so schwül wie im Rheintal, sondern sommerlich warm, meistens mit ein wenig Wind. Die Bauern seien jetzt im Heu. Viele Wiesen seien schon gemäht. Die Böden wären karg, so dass nur Weidewirtschaft infrage käme. Er lasse seine Wiese vor dem Haus wachsen und blühen. Erst wenn sie im Juli abgeblüht sei, mähe er sie mit der Sense.
Nach einer Gesprächspause wandte sich Hirschberg unvermittelt zu Kathas Freund: „War Ihre Prüfung erfolgreich?“
„Ich habe noch nicht das Ergebnis, aber es müsste geklappt haben. Lediglich bei einer Aufgabe war ich etwas unsicher.“
„Sie studieren Medizin, hat mir Katha gesagt. Im wievielten Semester?“
„Im achten.“
„Wann wollen Sie fertig sein?“
„Wenn es geht in drei Jahren.“
„Welche Fachrichtung wollen Sie einschlagen?“
„Da bin ich unentschlossen. Es gibt ein paar Bereiche, beispielsweise Neurologie, die mich besonders interessieren, aber ich könnte mir auch Pharmakologie als Spezialbereich vorstellen, um später in der Arzneimittelforschung zu arbeiten.“
„Wie sind denn die Chancen dafür?“
„Die Berufschancen sind für Ärzte recht unterschiedlich. Man muss sehr gut sein und die richtigen Kontakte haben, wenn man einen guten Einstieg bekommen will.“
„Und Sie haben beides! Wie sind Sie zur Medizin gekommen?“
„Meine Mutter ist Ärztin. Irgendwann habe ich gedacht, das mache ich auch.“
„Was macht Ihr Vater?“
„Der arbeitet als Direktor in der Stahlindustrie. Aber ich kenne ihn kaum. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich noch klein war. Mein Vater hat wieder geheiratet.“
„Dann vermute ich, Sie sind alleinerzogenes Einzelkind.“
Zu Katha: „Solche Jungs sind in der Regel sehr verwöhnt. Ist er das auch?“
„Seine Mutter verwöhnt ihn noch immer. Aber er ist dabei, sich mit meiner Hilfe zu emanzipieren.“
Hirschberg: „Und dafür hat dich seine Mutter besonders gern.“
„Ich versuche, sehr lieb zu ihr zu sein.“
„Was macht denn dein neuer Job?“
„Hat sich prima angelassen. Der Chef und die Kollegen – das ist eine prima Truppe; die haben mich mit offenen Armen aufgenommen. In Mallorca hat es indes Ärger gegeben. Als ich gekündigt habe, wurden sie so kleinlich, dass ich nur noch weg wollte. Meine Sachen habe ich zu meiner Freundin nach Palma geschafft. Da muss ich sie bald mal holen. Denn allzu viel Platz hat die nicht.“
Es war früher Nachmittag. Sie beschlossen, kein Mittagessen mehr zu machen, sondern statt dessen gleich die von Hirschberg vorgesehene Kaffeerunde zu veranstalten. Am Abend dann ein Candlelight-Dinner. Und Morgen die geplante Vennwanderung mit Picknick. Sie gingen ins Haus und Hirschberg zeigte ihnen die Räumlichkeiten. Er stellte ihnen für die Nacht zur Wahl: Das Wohnzimmer oder die Veranda. Im Wohnzimmer müsse einer auf dem Boden, auf der Veranda müssten sie Beide auf dem Boden schlafen; ihre Luftmatratzen und Schlafsäcke hätten sie ja dabei. Sie wählten die Veranda.
Die Arbeit für die Kaffeetafel wurde verteilt: Katha kochte den Kaffee, Günter richtete auf der Veranda die Kaffeetafel ein und Hirschberg holte die Fladen, Torte und Sahne aus dem Kühlschrank. Er zeigte, wo Geschirr, Besteck, Tischdecke etc. zu finden waren. Da er über die Autobahn gefahren war, hatte er in Roetgen die Gelegenheit zu einem kurzen Abstecher auf die belgische Seite, nach Petergensfeld genutzt. Dort gab es ein Kaufhaus mit Konditorei. Gekauft hatte er eine Obsttorte und zwei Reisfladen, eine Spezialität der Gegend.
Alles war vorbereitet und Kaffeeduft erfüllte die Veranda, als Katha von Günter die Autoschlüssel erbat und zum Wagen ging. Sie kam zurück mit einem Kerzenleuchter aus kunstgeschmiedetem Eisen, von dem sie das Geschenkpapier abzog.
Sie überreichte Hirschberg den Leuchter und der bedankte sich mit einer Umarmung und der Floskel, das sei aber nicht nötig gewesen.
Man nahm Platz. Katha schenkte den Kaffee aus, Günter servierte Torten- und Fladenstücke. Hirschberg betrachtete Günter: runder Kopf; hellblondes, kurzgeschnittenes anliegendes Haar; milchweiße Haut; grünliche Augen; blasse Augenbrauen. Er trug ein weißes Hemd mit kurzen Ärmeln, eine ebenfalls weiße Hose und weiße Lederschuhe – der Junge wollte ja schließlich Arzt werden. Katha war gekleidet, wie er das schon kannte: weißes T‑Shirt und blaue Jeans, Tennisschuhe.

Sie ließen es sich gut gehen bei Kaffee und Kuchen. Katha erzählte von Mallorca. Mit dem Spaziergang durch den Ort warteten sie noch, bis die Sonne etwas tiefer stand. Außerdem war es so gemütlich auf Hirschbergs Veranda, dass sie sich vorerst nicht erheben mochten. Die Teller waren leer. Sie schwiegen und genossen die Ruhe. Solche Ruhe ist indes für manche Menschen auf Dauer nicht zu ertragen. Ob es das war, fragte sich Hirschberg, als nach einer Weile Günter fragte: „Werden Sie den Sommer hier verbringen?“
„Ich weiß es noch nicht. Wenn das Wetter so bleibt und ich in Bonn meine Arbeit so geregelt bekomme, dass ich mich drei oder vier Wochen hierher zurückziehen kann, würde ich das gerne machen. Aber über längere Zeit stabiles Wetter gibt es hier oben nicht. Nach ein paar Sonnentagen kommt meistens ein Gewitter. Danach ist in der Regel wechselhaftes Wetter, nicht selten mit Temperaturen, die zehn Grad niedriger sind als vor dem Gewitter. Mal sehen, wie es dieses Jahr wird. Genießen wir den heutigen Tag. Nächste Woche ist Mitsommernacht.“
Katha: „Ja, 21. Juni. Aber wir machen heute schon das Candlelight-Dinner!“
Hirschberg: „Ich habe alles dazu eingekauft!“
Auf dem Dorfrundgang erzählte Hirschberg von den Zeiten, in denen die Menschen hier noch in großer Armut lebten. Er erläuterte die typischen Eifelhäuser, die liebevoll gepflegt und mit Blumenkästen geschmückt heute zwar hübsch aussehen würden und die vergangenen Zeiten als romantisch erscheinen ließen. Aber man solle sich nicht täuschen, das Leben sei hart gewesen und die jungen Leute seien abgewandert, hätten Arbeit in Aachen oder Stolberg gesucht, seien nur zu den Festtagen wie Ostern und Pfingsten und gelegentlich am Sonntag nach Hause gekommen.
Wieder zurück sah Hirschberg nach, ob er nicht im Schlafzimmerschrank Girlanden oder etwas Ähnliches hätte – Reste von einer Karnevalsfeier vor Jahren. Er fand eine Rolle Luftschlangen und zeigte sie Katha und sagte: „Damit dekorieren wir heute Abend. Was meinst du?“
„Das mache ich.“
Die beiden Männer zogen ihre Korbstühle an die Hauswand zurück, um ihre Köpfe anlehnen zu können. Katha setzte sich an den Tisch und breitete die Luftschlangenröllchen vor sich aus. Sie legte verschiedene Röllchen zueinander, um sich über Farbkombinationen schlüssig zu werden. Dann begann sie, Girlanden zu flechten. Die Männer sahen ihr zu.
Hirschberg überlegte, ob sie mit Günter wohl eine Familie gründen werde. Sportlich schien er nicht zu sein. Jedenfalls machte er von der Figur her und der Art, wie er ging und sich bewegte, nicht den Eindruck. Er fragte ihn. Nein, er spiele nur hin und wieder mit einem Freund Badminton. Im Winter gehe er einmal in der Woche ins Hallenbad, da sei eine Sauna, mehr mache er nicht. Ob er denn keine Lust habe, Tennis zu spielen, schließlich habe er ja eine Freundin, die es ihm beibringen könne. Da sei er unbegabt, er treffe nie den Ball. Katha bestätigte das. Was er denn mache, wenn er nicht gerade für sein Studium lernen müsse, wollte Hirschberg wissen. Er sei ein ziemlich häuslicher Typ, er koche gerne.
Hirschberg: „Das finde ich bewundernswert. Ich versuche es gerade zu lernen. Gar nicht so einfach.“
Jetzt hatten sie ein Thema. Katha war bei ihrer Arbeit, hörte aber zu und kommentierte gelegentlich mit Bemerkungen wie „Nach einer solchen Orgie solltest du die Küche sehen!“ oder „Das ist mein Lieblingsgericht!“ oder „Anschließend müssen wir zwei Tage lüften!“
„Sollte er denn nicht lieber Hausmann werden, statt Medizin zu studieren!“, fragte Hirschberg sie mit provozierendem Lächeln.
„Mit meinem Gehalt würden wir nie über einen besseren Studentenhaushalt hinauskommen“, erwiderte sie.
Hirschberg: „Dann muss er wohl oder übel Karriere in der Pharmaforschung machen.“
„Vielleicht hast du ein paar gute Kontakte, die ihm dabei helfen können.“
„Mal sehen, was sich machen lässt.“
„In Stolberg gibt es Grünenthal“, sagte Günter.
Hirschberg: „Penizillin ist aber schon erfunden.“
„Ich werde etwas Neues erfinden.“
„Einem Meisterkoch sollte das nicht schwer fallen.“
„Er probiert gerne Neues aus.“
„Das sind doch beste Voraussetzungen!“
Sie flachsten noch eine Weile weiter, dann beendete Katha die Unterhaltung mit der Bemerkung: „So, jetzt müssen wir diese Sommernachtsträume aufhängen.“
Zu dritt machten sie sich daran, die Girlanden anzubringen, stiegen auf den Tisch und die Sessel, banden sie mit Kordel an oder steckten sie mit Stecknadeln fest. Über die Türlampe stülpte Hirschberg einen Lampion mit Mondgesicht, der ebenfalls von der Karnevalsfeier übrig geblieben war. Es war schon acht Uhr, aber immer noch taghell. Hirschberg sagte, in Schweden würde es zu dieser Jahreszeit nur dämmrig, nicht dunkel. Da würde man die Nacht der Sonnenwende durchfeiern.
Katha: „Hast du Musik hier? Dann machen wir einen Sommernachtstanz!“
„Mozart habe ich, und Beethoven; zum Tanzen wohl nicht so geeignet.“
„Wir haben Kassetten im Auto. Hast du ein Kassettendeck?“
„Einen Walkman.“
„Wir können das Auto an die Veranda ranfahren“, schlug Günter vor.
Katha: „Zum Essen nehmen wir Mozart.“
Hirschberg: „Wie es euch gefällt!“
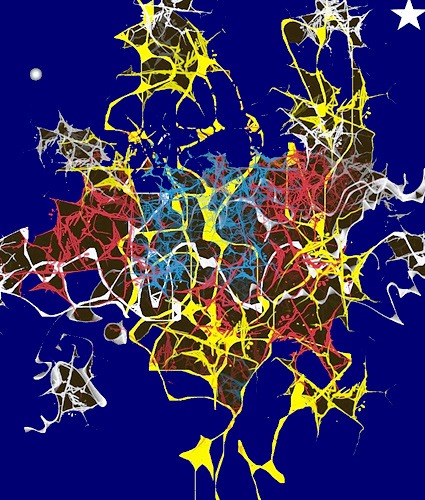
Sie begannen mit den Vorbereitungen zum Abendessen. Die Rollenverteilung wurde neu vorgenommen: Günter Küchenchef, Hirschberg Assistent, Katha Tischarrangeurin. Hirschberg hatte unter anderem verschiedenen Schinken, mehrere Wurst- und Käsesorten, französisches Stangenbrot, Tomaten, Eier, Champignons, Kopfsalat, Obst und belgische Pralinen eingekauft. Aus seinem Mehlemer Weinkeller hatte er ein paar Flaschen von der Loire und der Dordogne mitgebracht. Er überließ Günter die Auswahl. Schließlich waren verschiedene Salatschüsseln – grüner Salat, Tomatensalat, Eiersalat – Fleisch- und Käseplatten, eine Obstschale und ein Korb mit Brot fertig.
Katha zu Günter: „Wie wäre es vorab mit einer Champignoncremesuppe?“
„Wenn alle Zutaten da sind, gerne.“
Sie sahen nach, Günter checkte ab und meinte dann, es ließe sich etwas kreieren. Die Suppe dampfte, aus dem Wohnzimmer erklang Mozart, Katha entzündete die Kerzen des Leuchters auf dem Tisch. Auf ihre Initiative hin stellten sie sich um den Tisch, fassten sich bei den Händen und wünschten sich: „Guten Appetit!“ Dann nahmen sie Platz zum Mahle.
Günter bekam für seine Champignoncremesuppe überschwengliches Lob. Hirschberg erhob das Glas und sagte, er freue sich über ihren Besuch. Während des weiteren Essens warfen sie sich von Zeit zu Zeit Blicke zu, hoben den Kopf mit einem „Hm!“, und lobten nochmals den Koch.
Katha beobachtete Hirschberg. „Du strahlst so eine stille Freude aus!“
Er schmeichelte zunächst: Solch nette Besucher seien für ihn eine Freude. Dann nannte er den eigentlichen Grund: „Gestern Abend war meine Tochter bei mir. Ihr Studium läuft gut, sie ist verliebt und ihr Bruder kommt auch wieder zurecht. Das macht einen Vater froh.“
Da alle mit Essen fertig waren, begann sie das Geschirr abzuräumen. Die Männer erhoben sich und halfen. Als Nachtisch holte Hirschberg die belgischen Pralinen aus dem Kühlschrank. Sie waren mit Buttercreme gefüllt. Wieder erklangen mehrere „Hm! Hm!“
Der Himmel im Westen war rosa, die Sonne zu einem riesigen Glutball geworden. Hirschberg bot Liegestühle an. Sie stellten diese so auf, dass sie das Naturschauspiel der untergehenden Sonne vor sich hatten. Hätte man fotografiert, oder hätte ein Maler ein Bild davon gemalt – es wäre Kitsch geworden. Die Natur kannte keinen Kitsch. Sie weckte starke Gefühle der Sehnsucht; nach dem Ort, wo die Sonne nie untergeht, dachte Hirschberg. Es wurde dunkel. Eine laue Sommernacht.
Hirschberg trat ans Geländer und sah auf die Wiese. Ja, da waren sie: die Glühwürmchen. Sie tanzten auf und ab, leuchteten, erloschen, saßen „Licht an“ eine Weile still, schwebten weiter, plötzlich „Licht aus“; es waren viele, wurden immer mehr, Tanz der Irrlichter, der nur an Sommerabenden wie diesem stattfand. Mit leiser Stimme rief er die beiden zu sich und deutete auf die Wiese. Katha war entzückt. Lange standen sie und konnten sich nicht satt sehen. Schließlich fragte Hirschberg: „Wolltet ihr nicht tanzen?“
„Nein, die Musik würde jetzt stören.“
Die beiden begannen zu schmusen. Hirschberg wünschte “Gute Nacht” und zog sich zurück.
Lange lag er wach im Bett. Ihm fiel wieder der Schwedenurlaub ein. Wie sie ihren Lagerplatz erreichten, sich einrichteten und die Vorbereitungen für das Grillen trafen. Er hackte Holz, seine Frau kümmerte sich um die Lebensmittel. Die Kinder waren ganz aufgeregt: So in freier Natur ein Essen zubereiten, das hatten sie noch nicht erlebt. Er machte Feuer. Von den Vorgängern lag noch etwas Holzkohle zwischen den Steinen der Feuerstelle. Als das Holz zu Glut geworden war, kamen der Rost und die Töpfe darüber. In einem Topf wurden die Kartoffeln und in einem anderen Gemüse gekocht. Anschließend kamen in Alufolie verpackte Schweinefilets auf den Rost.
Auf dem Picknicktisch breitete die Mutter Servietten aus, jeder bekam einen Kunststoffteller, Campingbesteck und eine Emailletasse. Aus der Kühlbox gab es für die Kinder eine große Colaflasche, die Eltern hatten jeder eine Dose Bier. Dann kamen die Töpfe und die Folien mit dem Fleisch auf den Tisch. Es schmeckte vorzüglich. Zum Abschluss gab es Fruchtjoghurt. Geschirr, Besteck und Topf wurden mit Papier von der Küchenrolle, die die Mutter dabei hatte, gesäubert. Die Kinder halfen bei allem mit. Dann setzte man sich ans Ufer und genoss den Abend. Als es dämmrig wurde, blies der Vater die Luftmatratzen auf und legte sie im Holzverschlag aus, die Mutter machte die Schlafsäcke fertig, verteilte die Utensilien zum Zähneputzen.
Schließlich verkrochen sich alle zum Schlafen. Sie zogen die Schlafsäcke ganz zu, so dass nur noch die Nase rauskam. Denn es wurde kühl – und es gab viele Mücken!
Am nächsten Morgen wurden sie durch ein lautes und fortgesetztes Gagagack geweckt. Eine Gänsemutter schwamm mit ihren Kleinen im Gefolge die Bucht ab. Es wurde wieder ein herrlicher Tag. Die Hirschbergs paddelten auf einer anderen Route zu ihrem Campingplatz zurück. Mit diesen Erinnerungen schlief Hirschberg ein.
Als er am späten Morgen wach wurde und auf die Veranda ging, fand er die beiden noch schlafend in ihre Schlafsäcke gehüllt. Er ließ die Tür offen, legte eine Beethovenplatte auf und machte das Frühstück. Katha erschien und wünschte „Guten Morgen“. Sie verschwand im Bad. Einige Augenblicke später folgte ihr Günter. Hirschberg deckte im Wohnraum den Tisch. Beim Frühstück schwärmten die beiden von der herrlichen Nacht, sie hätten phantastisch geschlafen.
Für ihren Ausflug ins Venn bereiteten sie das Picknick vor. Butterbrote wurden geschmiert, eine Thermoskanne mit Tee gefüllt und Obst gewaschen. Die Salatreste von gestern Abend kamen in Plastikdosen. Die Beiden holten die Wanderstiefel aus ihrem Auto und luden sie zusammen mit dem Picknick-Rucksack in Hirschbergs Wagen.
Die Fahrt ging runter nach Roetgen zu Charlies Mühle an der alten Weser. Alte Weser deshalb, weil der Weserbach von hier aus unter der Wasserscheide hindurch in den Grölisbach abgeleitet wurde. So vermied man, dass die Verunreinigungen durch die Anwohner des Baches in die Eupener Talsperre flossen. Oberhalb Roetgens wurde die aus dem Venn kommende Weser über einen offenen Betonkanal – ein scheußliches Bauwerk mitten durch den Wald – in den Steinbach geleitet. Was ab hier dem Bach von Roetgener Häusern zufloss, ging also rüber in den Grölisbach, der sich mit dem Schleebach zur Vicht vereinigte.
All das und die Eigentümlichkeiten der Grenzziehung in dieser Gegend im Laufe der Geschichte erzählte Hirschberg seinen Wandergästen. Er vergaß auch nicht, von denen zu erzählen, die sich in früherer Zeit, als das Venn noch wesentlich größer als heute war, verirrt hatten und ums Leben kamen. Kreuze erinnerten an diese Schicksale.
Sie gingen über die Höhe des Vennbergs, der die Weser nach Westen zwang. Vor der Einmündung des Steinbachs gingen sie wieder zum Bach hinunter, folgten dann dem Steinbach aufwärts bis zur Einmündung des Eschbachs. Danach folgten sie diesem bis in sein Quellgebiet. Hirschberg ging diese Wege – es waren nur Pfade – deshalb so gerne, weil sie vorwiegend durch ursprünglich belassene Landschaft führten: Pfeifengras, Laubwald, Adlerfarn, Waldbeerbüsche. Streckenweise waren es nur schmale Zonen entlang der Bäche, dahinter begannen die schrecklichen Fichtenplantagen.
Über Jägerpfade wanderten sie durch einen lichten Birkenwald in Richtung Getzbach. Bevor es zu diesem, dem zweiten Zufluss der Eupener Talsperre, hinunter ging, kamen sie zu dem Picknickplatz, den Hirschberg vorgesehen hatte: eine Lichtung mit weitem Blick über die Landschaft. Von hier aus führte die Route nunmehr quer durchs moorige Gelände, streckenweise über Holzstege, nach Reinartzhof. Dort standen die Ruinen von ein paar Bauernhöfen, deren letzter vor mehr als 40 Jahren aufgegeben wurde. Weiter ging’s zurück zum Steinbach, den sie durch eine Furt überquerten, weiter ans Waldende und zum Auto.
Außer den Erklärungen, zu denen Hirschberg stehen blieb, redeten sie nicht viel auf dieser Wanderung. Meist gingen sie hintereinander, da die Pfade ein Nebeneinander nicht zuließen. Die beiden meinten, noch nie eine solche Landschaft gesehen zu haben. So etwas hätten sie eher in Skandinavien vermutet. Katha sagte, sie könne verstehen, dass Hirschberg sich in solch märchenhafter Landschaft wohlfühle, sie strahle eine solche Ruhe aus.